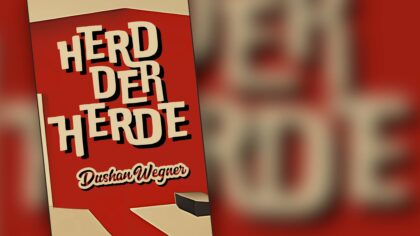Im Titel-Vorspann der Cartoon-Serie Die Simpsons werden die wichtigen Charaktere einer nach dem anderen durch lustige Szenen vorgestellt. Bart fährt gefährlich auf seinem Skateboard, Lisa spielt rebellisch auf ihrem Saxophon und so fort. Das Baby Maggie wird vorgestellt, indem ihre Mutter Marge sie aus Versehen auf das Laufband einer Kasse gesetzt hat und die Verkäuferin sie über den Scanner zieht. Die Kasse zeigt auch tatsächlich einen Betrag an! Lange Zeit waren es 847,63 US-Dollar, was wohl in 1989 die durchschnittlichen monatlichen Kosten eines Babys in den USA darstellte, in den letzten Jahren werden 486,52 Dollar angezeigt. (Selbst nachschauen: youtube.com, simpsonspedia.net)
Eigentlich sieht man die Zahlen nicht so einfach und direkt auf dem Scanner. Sie huschen schnell vorbei, man muss das Video anhalten und vergrößern, um die Beträge zu lesen, und das Beiläufige ist Teil des Scherzes. Die Maggie-Kassenscanner-Szene ist witzig, weil sie eine Doppelbedeutung von Preis und Wert schmerzhaft auf den Menschen anwendet: 1. Die Doppelbedeutung: Wird an der Kasse der Preis oder der Wert einer Ware gemessen?, und 2. Die schmerzhafte Anwendung: Wie messen wir den Wert eines Menschen? Was ist ein Mensch(enleben) wert?
Diese Frage nach dem Wert eines Menschenlebens ist nur auf den ersten Blick trivial. In einer ersten Reaktion möchte man ausrufen: Unendlich viel! Es gibt nichts, was sich mit einem Menschenleben aufrechnen ließe!
Doch, es stimmt nicht. Ein Menschenleben ist in der gelebten Praxis nicht »unendlich viel« wert. Mindestens im politischen Alltag wird eine ganze Reihe von Faktoren auf die andere Seite der Waagschale gelegt, und nicht immer kann ein einzelnes Menschenleben sie aufwiegen.
Den Preis wert
Am 12. Mai 1996 wurde Madeleine Albright, damals Gesandte der USA bei der UN, im Kontext der Sanktionen gegen den Irak während eines TV-Interviews von Lesley Stahl gefragt:
Stahl: »Wir haben gehört, dass eine halbe Million Kinder gestorben sind. Ich meine, das sind mehr Kinder, als in Hiroshima gestorben sind. Und, wissen Sie, ist der Preis es wert?«
Albright: »Ich meine, dass es eine sehr schwere Entscheidung ist, aber der Preis — wir meinen, dass der Preis es wert ist.« (meine Übersetzung; online nachschauen: YouTube, WikiQuote)
Die Absicht der Sanktionen (siehe etwa englische Wikipedia) war unter anderem, Irak zur Offenlegung seiner Waffen und zum Rückzug aus Kuwait zu bewegen.
Später würde Albright sagen, sie sei in diesem Interview in eine Falle geraten und das ganze Segment sei sowieso de facto irakische Propaganda gewesen. Doch dass Politik den Tod von Menschen in Kauf nimmt, um strategische Ziele zu erreichen, das steht außer Frage, ob diese konkrete Antwort nun verunglückt war oder nicht. In Ländern mit Todesstrafe steht das jeweilige Konzept von Recht und Gerechtigkeit über dem Wert des Lebens, bestreitet also den absolut höchsten Wert des Lebens. Spätestens wenn es um Wahrscheinlichkeit und pragmatisch zu Erwartendes geht, muss man fragen, ob durch die Aufhebung des Rechtsstaats im Bereich deutscher Grenzen nicht bewusst das Leben von Terrortoten und anderen Opfern importierter Gewalt aufgerechnet wurde gegen strategische Ziele, was auch immer diese sein sollten — während gleichzeitig erpressungsartiger Druck ausgeübt wird auf Länder wie Ungarn und Polen, welche die Sicherheit und das Leben der eigenen Bürger auch dann, wenn es um Statistik und Wahrscheinlichkeit geht, höher einschätzen als etwa die Befindlichkeit deutscher Eliten.
Nein, für die Politik ist — dem Himmel sei es geklagt! — das Leben nicht immer der allerhöchste Wert.
Ihre Kinder mehr lieben
Aus den Palästinensergebieten hören wir, wie bereits Kinder auf sogenanntes »Märtyrertum« hin erzogen werden. (Ein noch »harmloses« Beispiel: Kind rezitiert Märtyrergedicht im Radio, im Internet finden sich Tausende mehr, teils sehr bildstark.) »Märtyrer« ist ein perverser Euphemismus. Gemeint sind Selbstmordattentäter, die Juden ermorden sollen.
Golda Meir, Mit-Gründerin und später Premierministerin Israels, wird zitiert mit einem bemerkenswerten Satz: »Der Frieden wird kommen, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben als sie uns hassen.«
Ist der Satz wirklich von Meir? Es ist unklar. Doch von der Hamas inspirierte Palästinenser scheinen ihr täglich neu recht zu geben, via Facebook und all den anderen Internet-Plattformen. Nein, nicht alle Palästinenser sind fanatisierte Selbstmörder, und nicht alle Palästinenser stehen hinter solchen, die es sind! Palästinensische Journalisten und Intellektuelle etwa sprechen sich gegen solchen Missbrauch von Kindern aus. Sind sie damit erfolgreich? Dass zu viele jener Menschen die Juden mehr hassen als sie sich selbst und ihre Kinder lieben, das ist leider noch immer die Realität. Wie aber will man Frieden schließen mit jemandem, der in so unterschiedlicher Währung rechnet?
Der bittere Faden
In den letzten Tagen sind Nachrichten-Meldungen auf uns eingeprasselt, die nur auf den ersten Blick disparat scheinen.
Zuerst: In Hannover hat ein Kampfhund sein Frauchen und deren Sohn totgebissen. Die Reaktionen auf dieses schreckliche Ereignis sind bemerkenswert. Das Tier ist offensichtlich gefährlich und in solchen Fällen ist es eigentlich üblich, die Tiere einzuschläfern. Doch es formiert sich Widerstand von Tierschützern. Es brechen sogar irgendwelche Leute nachts ins Tierheim ein und versuchen mit Gewalt, das Tier zu befreien.
Dann: Beim Musikpreis »Echo« wurden antisemitische Witzlein geehrt. Zeitgleich erleben wir in Berlin ein neues »Man wird ja wohl wieder sagen dürfen«-Gefühl. Auf dem Titel der ZEIT wird das Land unter Israel als »arabisches Land« bezeichnet. Unter »Kultur« im selben Hause werden die beim ECHO geehrten Phantasien von jüdischer Weltverschwörung und die Witze über das Leid von Auschwitz erklärt und relativiert. Ein Herr Augstein zitiert anderswo einen Antisemiten; er wird dafür in der Jüdischen Allgemeinen kritisiert, und ruft als Verteidigung zur »Trennung von Künstler und Werk« auf.
Und auch: In Hamburg, am Jungfernstieg, hat Mourtala M., der als Flüchtling nach Deutschland kam, seine Ex-Frau und die gemeinsame einjährige Tochter getötet. Mit einem Messer. Bezeichnend war die Reaktion besonders der empörten Linken auf diese blutige Tat. Ein Flüchtling, dem alle Zuwendung und Willkommenskultur zuteil geworden war, tötet eine Deutsche und das gemeinsame Kind. Und wie reagieren die »Guten« in den sozialen Medien? Sie gehen ansatzlos zur Beschimpfung jener über, die über diese Tat entsetzt sind. Wer trauert, ist »Nazi«. Der Bürger mit Haltung hat Tote hinzunehmen. Angesichts eines leeren Kinderwagens mit rosa Rucksack sofort auf Trauernde und Oppositionelle einzudreschen, dafür bedarf es schon einer besonderen Kälte, einer besonderen Verachtung von Menschenleben.
Bis hin zu Blumenkriegen
Es fällt uns im Westen noch immer schwer, sich vorzustellen, dass Menschen in anderen Teilen der Welt einen ganz anderen Wert auf das Leben legen als wir.
Man verklärt gern die fernen Völker und alten Zeiten. Und man schimpft auf die Eroberer Amerikas, die ja auch bestimmt keine Heiligen waren. Man vergisst Kinderopfer der Inka, den Kannibalismus der Azteken und die Menschenopfer der Maya. Die Geringschätzung des individuellen Lebens durch jene Kulturen sprengt unsere moralische Vorstellungskraft. Spanische Priester, die solches noch miterlebt haben, berichten davon, dass die Eltern keine Traurigkeit zeigen durften, als ihnen die Kinder zwecks Opferung genommen wurden. Ja, seine Kinder zur Opferung freigegeben zu haben, das konnte einen gar für eine politische Karriere empfehlen, berichtet der Jesuit Bernabé Cobo. Die Azteken brachen zu Feldzügen auf, die sie »Blumenkriege« nannten, eigens zum Zweck, Nachschub für ihre Menschenopfer aufzutreiben.
Der Film 300 mag neben der griechischen Geschichte noch eine ordentliche Portion Hollywoodphantasie abbekommen haben, doch die Szene zu Beginn, in der die Spartaner ihre Säuglinge nur nach strenger gesundheitlicher Prüfung am Leben lassen, die ist nicht ganz falsch. Wo die Ressourcen knapp und die Feinde zahlreich sind, da scheint es manchen Völkern ein tödlicher Luxus zu sein, kranke Kinder großzuziehen. Wir Zivilisierten tun ja Ähnliches, doch dank Pränataldiagnostik können wir es vor der Geburt erledigen.
Liebesbriefe ins Gefängnis
Ich sehe in diesen drei Punkten eine gemeinsame Linie. Es gibt eine innere Gemeinsamkeit, welche die Kampfhund-Befreier (»Tierschützer«), die Antisemitismus-Versteher und den Kindesmörder verbindet.
Kampfhunde sind faszinierend — reden wir nicht drumherum — weil in ihren Kiefern das Potential steckt, einen Menschen zu töten. Mich erinnern die Menschen, die einen tödlichen Kampfhund aufnehmen wollen, an jene Frauen, die dem Massenmörder Charles Manson schmachtende Liebesbriefe ins Gefängnis schrieben. Der Fachbegriff dafür, sich von gefährlicher Gewalt angezogen zu fühlen, ist übrigens Hybristophilie.
Von Ernest Hemingway wird berichtet, dass er die Religionen in zwei Gruppen teilte: In jene, welche sich für ein Leben nach dem Tode vorbereiten, und jene, die dieses Leben feiern. Die einen wären nach Hemingway also Religionen des Todes, und die anderen wären Religionen des Lebens. Das Judentum war für Hemingway eine Religion des Lebens. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass Antisemiten sich so häufig mit Pistolen und Messern präsentieren. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass Linke, die für »importierten Antisemitismus« immer neue Erklärungen und Beschwichtigungen finden, mit ihrem Zynismus und Selbsthass gleichzeitig de facto auf den Suizid des Westens hinarbeiten. Antisemitismus ist (das ist meine These) im psychologischen Kern ein Hass aufs Leben selbst — und wer das Leben verachtet, ob er nun linker Kulturschaffender oder sonstwie verwirrt ist, der wird zuverlässig irgendwann beim Antisemitismus ankommen.
Und schließlich, der Mörder von Hamburg. Er stammt aus Niger, einem Land, das noch die Sklavenhaltung kennt. (Und nein, die heutigen Sklavenhalter sind nicht dicke texanische Christen mit Zigarre und Cowboyhut.) Er stammt aus einem Land, in dem über die Hälfte der Bevölkerung minderjährig ist, mit der zweithöchsten Geburtenrate (nach Angola) und der sechsthöchsten Säuglingssterblichkeit weltweit. (alle Angaben via cia.gov) Er stammt aus einem Land, in dem die Terrormiliz Boko Haram aus dem Nachbarstaat Nigeria eindringt um mit brutalster Gewalt ihr »Kalifat« zu erweitern. Das Auswärtige Amt schreibt so schlicht wie deutlich: »Von Reisen nach Niger wird dringend abgeraten.« — Sie mögen mich nun einen »Versteher« schimpfen, aber beantworten Sie sich einmal realistisch die Frage: Kann es eventuell sein, dass jemand, der aus der Hölle geflohen ist, in sich etwas davon mitgenommen hat? Ich war zwei Jahre alt, als meine Familie vor den tschechischen Kommunisten floh — und doch habe ich einiges an Tschechischem in mir mitbekommen. Wenn ein Jugendlicher oder junger Erwachsener aus einem Land kommt, in dem das Menschenleben in der Praxis leider weniger zählt als hier im Einzelkind-Helikoptereltern-Mit-dem-Anwalt-zur-Elternsprechstunde-Biodinkelwaffel-Westen, ist es nicht eventuell möglich, dass er etwas von der Umgebung seiner Kindheit mitbekommen hat?
Wir lieben das Leben!
Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass das Leben eines Menschen, ja das Leben insgesamt, nicht für alle Kulturen und Gruppen denselben Stellenwert hat. Wir im Westen, heute, halten das Leben für absolut heilig. Das sehen nicht alle so. Teile unserer Meinungsmacher flirten mit Selbsthass und finden Entschuldigungen für importierte Lebensverachtung. In anderen Regionen der Welt hat das Leben des Einzelnen, teils aus ideologischen und teils aus praktischen Gründen, einen anderen Stellenwert als für uns.
Von Osama bin Laden ist das provokante Zitat überliefert: »Wir lieben den Tod mehr als ihr das Leben liebt.«
Nein, bin Laden spricht nicht für die Leute, für die zu sprechen er vorgibt. Seine mörderische Provokation stellt dennoch uns, dem Westen, eine spannende Frage: Lieben wir denn das Leben? Sind wir bereit, jene aus unserer Mitte auszuschließen, die das Leben hassen und uns in ihrem Selbsthass mit hinabziehen wollen?
Es mag wie eine Banalität und eine Selbstverständlichkeit klingen, und doch ist es ein Zeichen der Zeit, dass es heute betont werden muss, dass es neu durchgesetzt und neu nachgezogen werden muss: Nichts, nichts ist wichtiger als das Leben.