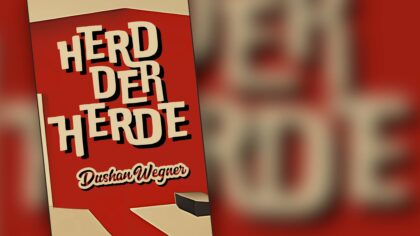Vier Fahrten, eine Stunde Wartezeit, eine Stunde Lauferei, doch lassen Sie mich mit dem Anfang beginnen!
Unser Filius übt sich seit einigen Wochen nun in der Kunst des Rollbrettfahrens (die jungen Leute nennen es »Skateboarden«), und Samstag früh geht er zum Unterricht in einer Halle für »extreme Sportarten«, mit vielen Holzrampen und Rhythmusmusik.
Nun ist es auch so, dass meine werte Gattin Elli und ich stets versuchen, nach vorne zu denken (Wayne Gretzky, »sein, wo der Puck sein wird« und so), und wir fahren schon länger gut damit, zum Fahren auf ein eigenes Auto zu verzichten. Wenn wir wirklich, wirklich eins brauchen, mieten wir es, ansonsten zeigen wir im Bus stolz unsere Monatskarten vor. Gestern wurde meine Begeisterung für moderne Mobilität ans Limit gebracht.
Am Vormittag waren Frau Gattin und Herr Sohn also zum »shredden« gefahren, ich blieb daheim, schreibend, wie es sich am Vormittag gehört. (Elli und ich entdecken gerade einige weniger bekannte Geschichten von Philip K. Dick neu, den sie auch in der Halle für Extreme Sportarten las, während sie wartete – sehr relevant für heute, dazu demnächst mehr!)
Leo beendete seine Stunde nicht. Noch vor Schluss brachte ihn der Skatelehrer heraus. Der Sohn hatte sich über Schmerzen im Ohr beklagt. Eine Freundin, deren Tochter dort auch skaten lernt, fuhr die beiden nach Hause – mit dem Auto. Daheim schien der Sohn etwas platt. Er legte sich hin, ganz freiwillig und jammerte weiter über sein Ohr.
Als Eltern vermutet man ja, was das bedeutet: Mittelohr. Auf also, zum Bereitschaftsdienst, denn es war Wochenende. Mit dem Bus. Dort dann angemeldet, ab ins Wartezimmer. Gewartet.
Während wir warten, schiebt sich ein sehr, sehr dünner Junge im Rollstuhl ins Wartezimmer, während seine Mutter noch vorne die Papiere klärt. Der Junge lächelt alle an, auch uns. Er schiebt seinen Rollstuhl nicht besonders gut, denn er ist wirklich sehr dünn, aber er schiebt, und er lächelt die Welt an. Er trägt ein Superman-T-Shirt. Es ist eine kleine Szene, wie man sie aus Filmen kennt, nur eben in echt.
Irgendwann sind wir dran. Es ist, was wir vermuteten. Es bewegt sich alles im Rahmen, auch da wir gar nicht erst abgewartet hatten. Der Arzt verschreibt Medikamente. Wir fahren heim.
Wir hatten vergessen, dass bei uns Stadtteilfest ist. Während wir beim Arzt gewesen waren, hatten sie die Straßen abgesperrt. Der Bus hielt ganz woanders. Und: Beide Apotheken waren geschlossen, der Notdienst war woanders.
Elli brachte also den Sohn nach Hause und ich nahm wieder den Bus in die Stadt. Ich fand eine offene Apotheke. Ich besorgte die Medikamente. An der Haltestelle stellte ich fest, dass die Feierlichkeiten ziemlich viele Feiernde anzogen. Ich fuhr mit einem Bus voll Jugendlicher in Feierlaune nach Hause.
Ich komme zu Hause an.
»Die Medizin ist da!«, rufe ich, stolz.
»Psst!«, sagt Elli, »er schläft.« Der Sohn war einfach eingeschlafen.
»Aber ich habe Hunger«, sagt Elli. Wir hatten noch nicht eingekauft, und das was sie sich wünschte, hatten wir nicht da.
Ich zog los.
Viel Tee
Ich war gestern Abend erschöpft. Ja, ich weiß, dass andere Eltern mehr leisten. Nein, ein paar Busfahrten und etwas Wartezimmer sind nicht sooo groß – und doch: Für mich persönlich war es ein Austesten dessen, was ich in der realen Welt außerhalb der Worte zu leisten fähig bin, ohne dabei einen Fehler zu machen. Kein Medikament vergessen, nichts irgendwo liegengelassen, alle am Ende versorgt, neben der Medizin auch mit frischer Nahrung und viel Tee.
Nein, ich hatte mein Tagespensum an Lesen und Schreiben nicht erfüllt. Nein, ich wünsche mir gewiss nicht, jeden Tag in Bussen und Wartezimmern zu verbringen. Und doch war ich am Ende des Tages sicher gewesen, das Richtige getan zu haben.
Wollen und Sollen waren kongruent. Meine Kreise waren geordnet. Ich spürte und wusste zugleich, was meine relevanten Strukturen waren.
A Good Crisis
Die Nachrichten vom Freitag hatten mir Samstag früh noch immer in den Knochen gesessen. Wie ich befürchtet hatte (siehe: Das Attentat von Christchurch – und das Manifest), wurde das Attentat instrumentalisiert von Politikern von Erdoğan (@RT_Erdoğan, 15.3.2019/archiviert) bis Chebli (@sawsan_chebli, 15.3.2019/archiviert), aber auch von den üblichen Haltungsjournalisten, um ihren politischen Gegner schnell einen reinzuwürgen.
Seit Jahren wird Kritik an einer Ideologie als »Phobie«, also eine Krankheit, verunglimpft, und es verwundert wenig, dass linke Populisten den Anschlag von Christchurch zynisch als eine Art von »Chance« sehen, störende Abweichler in die Nähe von Mördern zu rücken. Ich kenne ja den Satz des ehemaligen Obama-Stabschefs Rahm Emanuel, »you never want a serious crisis to go to waste«, es dann aber live zu erleben, das lässt mich doch erschaudern.
Der Terrorist von Christchurch wollte die Gesellschaft spalten – er sagt es ja explizit! Er gab den Bürgern der Empörungsgesellschaft die Steine, mit denen sie aufeinander eindreschen sollen – und die schwätzende Klasse greift stumpf reagierend nach den Felsen und wirft sie auf ihre politischen Gegner, ganz wie der Mörder es wünschte und plante.
Der Trauzeuge
Ich lese von Mesut Özil, der laut Medienberichten (siehe etwa welt.de, 16.3.2019) den türkischen Präsidenten Erdoğan bat, bei Özils Hochzeit mit Amine Gülşe als Trauzeuge zu dienen.
Letztes Jahr waren die türkischstämmigen deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan damit aufgefallen, sich mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan zu fotografieren und ihm ihre Spieler-Trikots zu schenken; Gündoğans Trikot trug die Widmung »Für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll«. Deutschlands Tralala-Elite war irritiert. Özil, dieses Beispiel für »gelungene Integration«, macht so was? Nein? Oh!
Man kann manches Verhalten präzise vorhersagen, indem man die relevanten Strukturen der Beteiligten ehrlich untersucht. Manchmal führt die Analyse anhand relevanter Strukturen zu Vorhersagen, die gegen die »offizielle« Berliner Meinung gehen – das sind dann die Fälle, wo sie sich hinterher alle »wundern«, »wie das passieren konnte«.
Ich schrieb damals einen Text zu Özil, der weitgehend gegen beide Seiten der Debatte ging. In der Einleitung schrieb ich:
Man kann Gündoğan & Özil fast verstehen. 2 Länder bieten sich als Heimat an: Eins mit Geld, das sich selbst hasst – und eins, das Menschenrechte anders definiert, aber Heimat sein will. Integration braucht ein Heimat-Angebot, braucht Werte und Identität. (Wie soll man sich integrieren in ein Land, das nicht Heimat sein darf?, 17.5.2018)
Der Westen hat Özil viel Geld gegeben, die Türkei aber bietet ihm eine Heimat. Was nutzt dir alles Geld der Welt, wenn du kein Zuhause hast?
Özil hat nun – wenn die Berichte stimmen – Erdoğan gebeten, sein Trauzeuge zu sein. Nach dem Trikot-Eklat lud sich Özil noch beim deutschen Bundespräsidenten ein, als eine Art bildstarker Rehabilitation, wo die Bilder leisten sollten, was man in Sprache gar nicht sagen wollte. Hinterher formulierte Steinmeier etwas von »Heimat gibt es auch im Plural« (spiegel.de, 19.5.2018) – wenn Steinmeier etwas sagt, dann ist es nicht vollständig unvernünftig, davon auszugehen, dass in Wahrheit das Gegenteil richtig sein kann.
Sawsan Chebli, Berliner Staatssekretärin inoffizielles Gesicht der SPD, formuliert im Das-hat-keiner-kommen-sehen-Tonfall:
Hab Özil damals verteidigt. Sein Satz: »ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren«, hat mich so getroffen. Was er nun macht, ist enttäuschend. Er ist Vorbild für Millionen junger Menschen. Finde es verantwortungslos. (@sawsan_chebli, 16.3.2019)
Verantwortung gegenüber wem? Özil ist zuerst verantwortlich für sich und seine Familie. Ich nehme einfach mal an, dass er nach der Hochzeit auch Kinder plant.
Ich schrieb letztes Jahr:
»Wir hassen uns selbst, hier ist unser Geld, jetzt integriert euch!« – das ist kein Heimat-Angebot, das ist lähmende Selbstverlorenheit. (…)
Integration braucht ein Heimat-Angebot. Damit sich irgendwer, ob Fußballspieler, Flüchtling oder »Flüchtling«, in Deutschland integrieren kann, muss es sich selbst zunächst erlauben, eine Heimat zu sein. Selbsthass ist kein Wert, Selbstaufgabe ist kein Wert, allzu große Selbstlosigkeit endet bald in eigener Hilflosigkeit. (Wie soll man sich integrieren…, 17.5.2018)
Özil muss in der realen Welt handeln, er hat die Länder zur Auswahl, die es real gibt, inklusive ihrer Präsidenten. Seine Religion ist nicht meine Religion. Seine Luxus-Lebensumstände sind wahrlich nicht meine Lebensumstände. Doch als jemand, der seine »Kreise« zu ordnen versucht, als Vater kann ich ihn verstehen. Özil ist für seine zukünftige Familie verantwortlich, nicht für die Aufrechterhaltung der Phantasien der Eliten in Berlin oder Brüssel.
Sie mich auch (nicht)
Gerade nach Tagen wie gestern (Busfahrten zur Bereitschaft etc.) und vorgestern (Terror in Neuseeland) kann ich das Geschwafel der Berliner Schönschwätzer nicht ertragen.
Für die Regierungsparteien des einst ernstgenommenen Deutschland sprechen junge Herren, für die »Milchgesicht« (bild.de, 16.1.2019) schlicht eine präzise Zustandsbeschreibung ist.
Ich mag die dahinwabernden Phrasen der Berliner Nebelwerfer gerade nicht hören. Amthor? Kühnert? Chebli? Poschardt? Merkel? Hayali? Ich bitte Sie! – Man sagt, was gesagt werden muss, um im Berliner Zirkus in die Manege zu dürfen, mal von der großen Trommel begleitet, mal von der Tröte, gelegentlich über die viel großen Clownschuhe stolpernd und doch stets wieder auf den Füßen landend. Selbst wenn die das Richtige sagen, fürchtet man, dass sie es aus den falschen Gründen tun.
»Man sollte die AfD nicht unnötig groß reden« (welt.de, 16.3.2019), findet Philipp (26) – ja, klar, Philipp, es ist das Über-die-AfD-Reden, das die AfD groß gemacht hat, nicht etwa die Angst der Menschen davor, vor die eigene Haustür zu treten.
Es ist ja nicht nur Berlin! – Paris brennt, buchstäblich, Bilder wie aus dem Bürgerkrieg, doch Emmanuel »Jupiter« Macron samt Gattin müssen erst einmal aus dem Skiurlaub zurückgeholt werden (welt.de, 17.3.2019 – schauen Sie sich das Foto des Ex-Bankers auf der Skipiste an).
Nein, diese Leute kennen mein Leben nicht. Mein Leben ekelt diese Leute an. Meine Sorgen empfinden sie als unmoralisch – ich bin ein »besorgter Bürger«, und Sorgen zu haben ist diesen wohlversorgten Sorgenfreien etwas Schändliches.
Der 48-jährige Vater, der den Mörder von Christchurch aufhielt (dailymail.co.uk, 16.3.2019), den bewundere ich, und ich wage zu sagen, dass ich ihn auch verstehe – möge ich nie in die Situation kommen, dass mein Mut auf ähnliche Weise getestet würde. Den zukünftigen Ehemann Özil verstehe ich – und die mutigen Menschen, die aus Sorge um ihr Land gegen Özils Wunsch-Trauzeugen demonstrieren, selbst wenn der sie dafür ins Gefängnis werfen kann, die verstehe und bewundere ich. Ich verstehe jeden, der Verantwortung übernimmt für seine relevanten Strukturen – und ich bewundere die, die ihre Kreise extra groß und doch konzentrisch ziehen.
Die Spalter und Instrumentalisierer und einen guten Teil der Journalisten in Berlin verstehe ich nicht – und die mich auch nicht. Für die* ist Heimat ein Schimpfwort, für mich ist Heimat eine Sehnsucht. Die* kämpfen für Abtreibungen ohne Hindernisse, ich kämpfe gegen die Ohrenschmerzen meines Kindes. Die* denken nicht weiter als bis zur nächsten Talkshow und vielleicht noch bis zum nächsten lukrativen Pöstchen, ich sorge mich um eine Zukunft, in der ich längst nicht mehr leben werde. (* Nicht alle, ich weiß.)
Ich begreife
Mein Schreibtag begann auch heute früh, noch bevor die Familie wach wurde, doch eben ist die Tür aufgegangen. Leo ist hereingekommen. In der Nähe meines Schreibtisches steht ein Bett, und dort will er weiterschlummern.
Ich nehme die Kopfhörer ab, wie es sich gehört.
»Hör ruhig deine Musik«, sagt der Sohn, und dann sagt er weiter: »Mama hat mir heute Nacht die Tropfen ins Ohr gegeben.«
»Willst du etwas trinken?«, frage ich.
»Nee, Mama hat mir vorhin zu trinken gegeben.«
Der Sohn dreht sich um und deckt sich zu. Ich ziehe die Kopfhörer wieder an, starte Spotify (»Jazz Classic Blue Note Edition«), und ich begreife: Während ich schlief, stolz erschöpft ob meiner väterlichen Heldentaten, hat Elli in der Nacht einfach weitergemacht.