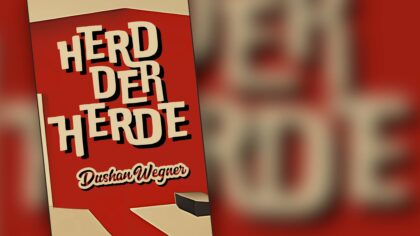Es war eine Zeit der Unordnung, des stillen Kriegs und des dummen Lärms. Bauern fürchteten, zu säen, aber nicht ernten zu dürfen. Räuber ernteten, was sie nicht gesät hatten, und am Hof des Königs konnte man kaum noch sagen, wer die Hofnarren waren und wer die Beamten. Manche Bürger flohen, andere flehten ihre Kinder an, zu fliehen, und hofften, dass ihre Kinder nicht zurückfragen würden, wohin sie denn fliehen sollten.
»Ach«, seufzte ein Schüler, »wenn wir nur Hoffnung hätten!«
»Was ist Hoffnung?«, fragte der Meister zurück.
Der Schüler wusste nicht, wie er gleich antworten sollte.
»Ich will anders fragen«, sagte der Meister, »nämlich: Was ist Vertrauen?«
Der Schüler gestand: »Ich verstehe nicht!«
Der Meister nickte, und er fragte: »Als du ein Kind warst, und deine Mutter rief dich zum Abendessen, hast du ihr geglaubt, dass sie dir auch wirklich ein Abendessen geben würde?«
»Selbstverständlich«, sagte der Schüler, »auch heute noch!«.
»Schön, sehr schön«, sagte der Meister, und er fragte weiter: »Wenn du etwa von einer Mauer oder von einem Baum herunter springen wolltest, und wenn dein Vater unten stand und dir sagte, dass er dich fangen würde, hast du ihm geglaubt?«
»Selbstverständlich«, sagte der Schüler wieder, doch er wurde wehmütig, denn sein Vater lebte nicht mehr.
Der Meister nickte, und er fragte weiter: »Wenn deine Mutter dir nicht in Worten gesagt hätte, dass es ein Abendessen geben wird, hättest du nicht dennoch vertraut, dass du nicht hungrig zu Bett gehen wirst? Braucht es denn wirklich Worte, um zu wissen, dass dein Vater dich auffangen wird?«
Der Schüler nickte, dachte nach, und dann sagte er: »Wenn die Mutter die Kraft und die Möglichkeit hat, wird sie mir zu essen geben, das glaube ich. Und wenn der Vater da ist und sieht, dann wird er mich fangen.«
»Das«, sagte der Meister, »das ist Vertrauen. Du vertrautest deiner Mutter, dass sie dich nähren wird, und deinem Vater, dass er dich fangen wird.«
Der Schüler nickte.
»Doch«, sagte der Meister, »doch wir sprachen von der Hoffnung.«
»Richtig«, sagte der Schüler, der in Gedanken bei seinen Eltern war, bei seiner Kindheit, »ich fragte nach der Hoffnung.«
Der Meister sagte: »Du vertrautest darauf, dass deine Mutter dir Nahrung geben wird und dass dein Vater dich auffangen wird, doch ein Unfall, eine Krankheit oder auch nur eine Unaufmerksamkeit hätten es verhindern können.«
Der Schüler warf ein: »Ich beschließe, zu vertrauen!«
Der Meister fragte: »Glaubst du auch, dass die Sonne morgen aufgehen wird?«
Der Schüler nickte wieder, und sagte: »Bislang ist sie immer aufgegangen.«
»Und glaubst du«, fragte der Meister, »dass morgen die Sonne auch scheinen wird, dass es nicht nur hell sein wird, sondern auch sonnig, warm und angenehm?«
»Ich hoffe es!«, rief der Schüler.
Der Meister lächelte. Er sagte: »Du beschließt, darauf zu vertrauen, dass die Sonne morgen nicht nur aufgehen wird, sondern auch warm scheinen und unsere Seelen erfreuen wird.
Zu beschließen, darauf zu vertrauen, dass es gut wird, das ist Hoffnung.
Die ganz allgemeine Hoffnung, die Hoffnung als Lebenseinstellung, das ist der Beschluss zum Vertrauen.
Hoffnung ist das Vertrauen in die Welt, dass sie unter den vielen Möglichkeiten eine von jenen wählen wird, die uns nicht weh tun, die uns vielleicht sogar ein wenig Glück bringen.«
Der Schüler fragte: »Haben wir denn einen Grund zur Hoffnung?«
»In wessen Auftrag fragst du?«, erwiderte der Meister.
Der Schüler stellte seine Frage neu: »Habe ich einen Grund zur Hoffnung?«
Der Meister fragte zurück: »Worauf vertraust du?«
Der Schüler wagte es, diesmal selbst zurück zu fragen: »Worauf vertraut ihr?«
»Die Sonne wird morgen wieder aufgehen«, sagte der Meister, »und wenn sie aufgeht, und wenn auch wir morgen am Leben sind, dann haben wir morgen eine neue Gelegenheit, nach Hoffnung zu suchen.«
»Darauf vertraut ihr?«, fragte der Schüler.
Der Meister lächelte, und er sagte: »Darauf hoffe ich.«
Vergessen wir nicht!
Man könnte sich heute etwas hoffnungsschwach fühlen, wenn man in die Nachrichten schaut. Ulrich Wilhelm, einst Pressesprecher der Merkel-Regierung und heute aktueller ARD-Chef (hat da jemand »Drehtür« gerufen? Psst!), hat jüngst, so etwa pfaelzischer-merkur.de, 7.11.2019, kritisch angemerkt, dass man auf Facebook keine »Rundfunklizenz« braucht. Wir lesen aktuell vom Macheten-Angriff auf die Dorfdisco (bild.de, 7.11.2019), vom Raubüberfall, der jedem von uns widerfahren könnte (focus.de, 8.11.2019), und so fort – und derweil wird beim Bürger die Angst geschürt, die eigene Meinung zu sagen (siehe auch »Ich bin satt, also hat niemand Hunger«). Doch, vergessen wir zugleich nicht, dass es noch immer viele Bürger gibt, die hart arbeiten, um sich, ihre Familien und damit auch die Gesellschaft insgesamt zu stützen, die etwa in Bergwerken wie dem in Teutschental schuften, und wir freuen uns mit, dass die 36 nach einer Verpuffung tief in der Erde eingeschlossenen Kumpel befreit wurden (siehe etwa bild.de, 8.11.2019).
Krisenvielfalt
Man wird sich schnell darauf einigen können, dass Deutschland derzeit von einer oder mehreren Krisen gequält und geschüttelt wird. Was ist denn aber die größte und brennendste unter den Krisen? Die Antwort hängt davon ab, wen man fragt und wie frei derjenige gerade reden zu können meint. Wenn man einen einfachen Bürger fragt wird man womöglich eine andere Krise genannt bekommen als wenn man eine jener »NGOs« fragte oder einen Politiker der Regierungsparteien. Die einen erleben eine Migrationskrise und eine gefühlte Erosion des Rechtsstaats, die anderen erleben in der aktuellen Sehnsucht nach Freiheit, Recht und Ordnung eine Krise, der sie durch Stigmatisierung und via »Kampf gegen Rechts« begegnen wollen.
Ich verstehe die diversen Krisenbeschreibungen, und ich wage selbst, eine Krise zu diagnostizieren: Der Westen erlebt eine Hoffnungskrise.
Die sozialen Verwerfungen infolge der Grenzöffnungs-Euphorie stellen eine eigene Krise dar, die man auf den Plätzen und in freien Medien verfolgen kann. Die schleichenden Einschränkungen von Freiheiten und Möglichkeiten der Bürger, stets im Namen vorgeblicher Moral, stellen ebenfalls eine eigene Krise dar. Doch, all diese Probleme und Teil-Krisen würden sich weit weniger dramatisch anfühlen, wenn darüber nicht eine weitere Krise wabern würde: Probleme sind weit schmerzhafter, und werden oft dadurch erst zur Krise, wenn Menschen nicht mehr darauf vertrauen, dass es auf die eine oder andere Art besser werden kann.
Bei der Formulierung des Satzes »Der Westen erlebt eine Hoffnungskrise« habe ich darauf geachtet, nicht davon zu reden, dass die Hoffnungskrise »durchlebt« würde, oder anders zu implizieren, dass das Herauskommen aus der Hoffnungskrise in irgendeiner Form automatisch passieren könnte. Ja, es gibt Entwicklungen, die zyklisch passieren, doch nicht alles ist zyklisch, zumindest haben nicht alle Zyklen eine vorab abzusehende Länge – und der Unterschied zwischen »ewig« und »ohne abzusehendes Ende, möglicherweise hundert Jahre« ist von semantischer Natur und ist für den, der drin steckt, wenig tröstend.
Zwischen Null und Eins
Hoffnung, so erzählt die kleine Geschichte vom Meister und seinem Schüler, ist der Beschluss, darauf zu Vertrauen, dass es schon gut werden wird – mit viel Spielraum (manchmal schmerzhaft viel) für die Bedeutungen von »es«, »gut« und »werden«.
Eine begründete Hoffnung setzt voraus, dass jene Möglichkeiten, die mir als gut erscheinen, in Summe eine Wahrscheinlichkeit weit genug über Null aufweisen können. Damit eine Hoffnung keine Illusion und kein Wahn ist, damit das Vertrauen in zumindest die Möglichkeit eines guten Ausgangs gerechtfertigt ist, damit meine Hoffnung einen Grund hat, dafür muss das, auf dessen Möglichkeit ich vertraue, eben nicht zu unwahrscheinlich sein.
Einen Lottoschein zu kaufen, und dann darauf zu hoffen, dass man gewinnen wird, und bereits damit zu planen, das wäre wenig gerechtfertigt. Darauf zu hoffen, dass morgen die Sonne aufgeht, das wäre wiederum zu schwach gesagt, denn dass die Sonne aufgeht, das hat dann doch eine Wahrscheinlichkeit nahe Eins, sprich: Es ist sicher.
Worauf darf der Mensch hoffen? Worauf wir hoffen, das sollte schon etwas sein, dessen Wahrscheinlichkeit muss höher als Null sein – und damit die Hoffnung einen Grund hat, ein Fundament der Wahrscheinlichkeit, dafür sollte sie auf der Skala der Wahrscheinlichkeit gut fortgeschritten sein auf dem Weg von Null nach Eins.
Hoffnung, wie das Glück
Worauf sollen wir hoffen? Anders und genauer gefragt: Was ist der Grund unserer Hoffnung?
»Die anderen« haben keine andere, bessere Hoffnung, sie haben nur Angst anzubieten – Angst vor dem Weltuntergang, Angst davor, aus der Reihe zu tanzen, und zuletzt die Angst davor, selbst zu denken. Jene, die uns die Hoffnung rauben, haben keine bessere, andere Hoffnung anzubieten. Man nimmt uns die Hoffnung und gibt nichts als Angst und Sorge zurück. Die vermeintliche Hoffnung derer, welche uns die unsere nehmen, gleicht doch der Euphorie des Betrunkenen – und diese Leute sind ja wahrlich an ihrer eigenen Moral besoffen und vergiftet – welcher fröhlich lallend in die Glasscheibe torkelt und lacht, und die Nüchternen, die den Schnaps der linken Lügen nicht vertragen und gar nicht vertragen wollen, wir schauen erschrocken zu, und wir fragen uns, wie wir dem so gefährlich Torkelnden aus dem Weg gehen können.
Nicht »Hurra!« und »Wir schaffen das!« zu rufen gibt uns Hoffnung, sondern einen Grund zu haben für das Vertrauen darein, dass die Dinge gut werden können. Hoffnung, wie das Glück, wird erarbeitet. Eine Gesellschaft, die von Hoffnung getragen sein möchte, muss sich genug Gründe fürs Vertrauen erarbeiten.
Der Einzelne kann immer nur so viel ausrichten, um der Gesellschaft neue Hoffnung zu geben. Gerade in der Demokratie sind die Möglichkeiten des Einzelnen beschränkt – und das ist gut so. Das bedeutet aber auch: Wenn eine Demokratie die Gründe der Hoffnung zu schleifen droht, liegt es um so mehr am Einzelnen, für sich selbst ein neues Fundament für sein Zukunftvertrauen zu bauen, für sich selbst gute Möglichkeiten erarbeiten, deren Wahrscheinlichkeit deutlich größer als Null ist – und sei es der Innenhof, den er für sich und seine Lieben einrichtet.
Die Hoffnung wird uns heute nicht von oben gegeben, weniger noch als noch vor kurzem. Jubeln können wir nicht, und aufgeben wollen wir auch nicht. Gebt eurer Hoffnung ein neues Fundament, gebt eurem Vertrauen neuen Grund, und tut es selbst, denn niemand wird es für euch tun.